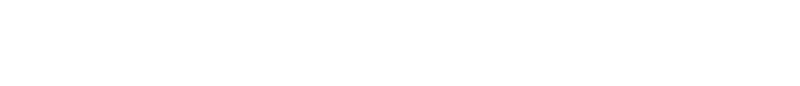Fadenspiele im Museum Tinguely
21.11.24 15:17 Abgelegt in:
Kunst und Kultur

S
chneckenforscher Hans-Rudolf Haefelfinger 1975 auf dem Dach des Basler Naturhistorischen Museums die Schwestern Dunia Lingner und Ruth Altenbach beim Fadenspiel. Die Kuratorin und der Kurator baten die Schwestern jetzt zum Interview. Das Video ist eines der Highlights der Ausstellung. Überhaupt: Allen, die sich vor allem für das Spielerische interessieren, bietet die Schau zahlreiche Anregungen. Gleich links der Treppe, noch bevor man sich zur Ausstellung wendet, werden in einem Video einfache Fadenspiele zur Nachahmung vorgeführt. Garnschnüre stehen zur Verfügung.
An zwei Beispielen möchte die Schau auch Künstler als Fadenspieler vorstellen. Im Falle von Marcel Duchamp, der 1942 in New York zur Surrealisten-Schau «First Papers of Surrealisme» durch das Fadengespinst «His Twine» beitrug, das den Blick auf die Werke der Kollegen (darunter Paul Klee, Max Ernst, Paul Chagall, Pablo Picasso) behinderte, ist der Zusammenhang nicht überzeugend. Und in der Sequenz, die Andy Warhol im Rahmen seiner rund 500 dreiminütigen «Screen Tests»von Harry Smith (1923-1991) machte, einem Beatnik-Häuptling, der unter anderem amerikanische Volksmusik und Fadenspiele sammelte, ist höchstens zu erahnen, dass er bei der Aufnahmen mit Fäden hantiert. Zu sehen ist nur sein Gesicht.
G
ewiss, die Kuratorin und der Kurator, die beide seit vielen Jahren an Universitäten und Kunsthochschulen forschen und lehren, bezeichnen ihre Präsentation als «forschende Ausstellung». Vielleicht wollen sie damit signalisieren, dass ihre Arbeit wissenschaftlich, das heisst: immer offen für neue Erkenntnisse verstanden werden soll. Für das Publikum bedeutet das leider, dass eine Vielzahl von Themen angesprochen, aber nicht abschliessend abgehandelt werden. (Ein Bild von der akademischen Debatte über Fadenspiele bietet die Besprechung eines Zürcher Workshops aus dem Jahr 2023, auf einer Website des eikones-Studiengangs an der Uni Basel https://www.bildundkritik.ch/posts/review-string-figures-an-interdisciplinary-workshop) Das Spielerische und die Beteiligung des Publikums, die für Jean Tinguelys Kunst so wichtig sind, werden in dem akademischen Setting der Kuratierenden durch dem Zeitgeist geschuldete Selbstzweifel und Bedenken überschattet. Neben einer Videoinstallation mit Dutzenden ethnologischer Fadenspiele-Aufnahmen aus dem Fundus der «Encyclopaedia Cinematographica» (EC) ist in der Erläuterung zu lesen: «Die Frage des Zugangs und des Zeigens respektive Nicht-Zeigens ethnologischer Filme - und damit auch tausender Filme aus der EC - ist k
omplex. [...] Die Frage nach dem Zeigen hat auch Mario Schulze und mich als Kurator:innen im Zuge der Ausstellungsvorbereitungen beschäftigt Können wir diese Filme öffentlich vorführen? … Die gefilmten Personen konnten jedenfalls nicht wissen, was mit ihren Aufnahmen alles passieren sollte. Wie ist es für sie, dass ihre Aufnahmen im Rahmen einer Kunstausstellung in der wohlhabenden Schweiz vorgeführt werden? Wie ist es für ihre Nachfahren, für ihre Community? Sind sie stolz? Ist es befremdlich für sie? Welcher Blick nimmt die Kamera im Film ein und inwiefern ist dieser kolonial geprägt?» Darf man sagen, dass diese Art von Bekenntnis zur Beschränkung der eigenen Forschungsfreiheit, die allenfalls akademisch diskutabel ist, in einer Ausstellung über eine weltweit geübte und dokumentierte Kulturtechnik keinen Erkenntnisgewinn vermittelt? Zum Glück erfreut uns der fröhliche Tik-Toker David Keťacik Nicolai auch beim Hinausgehen noch einmal mit seinen kunstvollen Fadenspielen…
Illustrationen: Videostill aus der Ausstellung (David Keťacik Nicolai, Foto: Christoph Oeschger); Videostill aus der Ausstellung (Dunia Lingner, Ruth Altenbach, Bild: Hans-Rudolf Haefelfinger); ; Marcel Duchamp, 1942 (Foto John Schiff, Courtesy of the Leo Baeck Institute’s John D. Schiff Collection); String Games der Maori in Neuseeland (Maureen Lander, Sammlung des Museums von Neuseeland Te Papa Tongarewa, 1998).Tags:Museum Tinguely Basel, Mario Schulze, Sarina Waltenspül, David Keťacik Nicolai, Andres Pardey, Franz Boas, Hans-Rudolf Haefelfinger, Dunia Lingner, Ruth Altenbach, Harry Smith, Marcel Duchamp, Andy Warhol